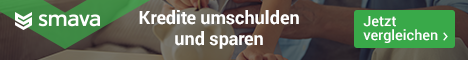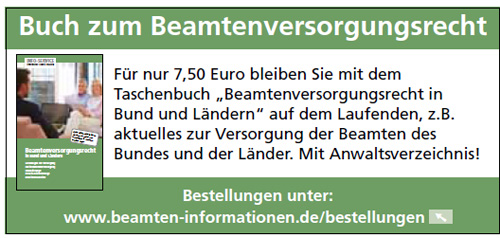Achter Versorgungsbericht der Bundesregierung - Zusammenfassung -
|
Neu aufgelegt im Mai 2025: Hier zu den ausgewählten Anwälten mit dem Schwerpunkt "Verwaltungsrecht und Beamtenrecht" |
|
Achter Versorgungsreicht der Bundesregierung vom 25.07.2025
Zusammenfassung
Deutscher Bundestag – 21. Wahlperiode - Drucksache 21
Einleitung
1. Berichtsauftrag und Vorbemerkungen
Gesetzliche Grundlage
Gemäß § 62a Absatz 1 Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) hat die Bundesregierung dem Deutschen Bundestag in jeder Wahlperiode einen Versorgungsbericht vorzulegen. Dieser Bericht soll die jeweils im Vorjahr erbrachten Versorgungsleistungen im öffentlichen Dienst des Bundes, aber auch Vorausberechnungen der zumindest in den nächsten 30 Jahren zu erwartenden Versorgungsleistungen umfassen. Gemäß § 10 Absatz 6 Altersgeldgesetz (AltGG) wird auch zum Altersgeld des Bundes berichtet.
Infolge der 2006 in Kraft getretenen Föderalismusreform enthält dieser Bericht nur Ausführungen zu den Entwicklungen im Bundesbereich. Für Ausführungen zu Entwicklungen in den Ländern sind ausschließlich diese zuständig.
Wie bereits beim Siebten Versorgungsbericht der Bundesregierung1 enthält dieser Bericht auch das Ergebnis der Überprüfung der Auswirkungen der Anhebung der Altersgrenzen für Beamtinnen und Beamte des Bundes (Altersgrenzenbericht). Die Bundesregierung hat gemäß § 147 Absatz 2 Bundesbeamtengesetzes (BBG) die Anhebung der Altersgrenzen regelmäßig zu überprüfen. Nicht berichtet wird zum Umsetzungsstand der Anhebung der Altersgrenzen von Berufssoldatinnen und Berufssoldaten. Diese nach § 45 Absatz 4 Soldatengesetz (SG) geltende Berichtspflicht wird gesondert erfüllt.
Wegen des vorzeitigen Endes der 20. Legislaturperiode konnte dieser Achte Versorgungsbericht erst zu Beginn der 21. Legislaturperiode vorgelegt werden. Dem neu gewählten Bundestag stehen damit aktuelle Daten und Angaben zu erbrachten Versorgungsleistungen und Vorausberechnungen zu den zu erwartenden Versorgungsausgaben zur Verfügung.
Struktur dieses Versorgungsberichts
Nach Vorstellung ausgewählter Themen folgt eine Kurzzusammenfassung des Achten Versorgungsberichts. Im Weiteren entspricht der Aufbau dem Siebten Versorgungsbericht. In den Kapiteln I bis III werden die Entwicklungen der Beamten-, Richter- und Soldatenversorgung des Bundes überwiegend im Basisjahr 2023 betrachtet und in Kapitel IV die Vorausberechnungen bis 2060 beschrieben. Es werden die Entwicklung der Versorgungsausgaben und deren wesentliche Bestimmungsgrößen, wie bspw. die Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, das Ruhestandseintrittsverhalten sowie die durchschnittlichen Ruhegehälter und Ruhegehaltssätze dargestellt. Dabei wird zwischen dem unmittelbaren Bundesbereich und den sonstigen Bereichen des Bundes unterschieden. Kapitel V widmet sich dem Altersgeld des Bundes, einer Alterssicherungsleistung für freiwillig aus dem Bundesdienst ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Berufssoldatinnen und Berufssoldaten.
Die in den Kapiteln I bis V dargestellten statistischen Ergebnisse sind Zusammenfassungen von Ausgangsdaten, die sich aus den Angaben zu einzelnen Personen zusammensetzen. Zur Sicherstellung des Schutzes von Angaben zu einzelnen Personen wird ein Rundungsverfahren angewendet. Die dargestellten Fallzahlen wurden zunächst ohne Rundung ermittelt.
Anschließend wurde jede Zahl für sich auf ein Vielfaches von fünf auf- oder abgerundet. Dieses Verfahren führt nur zu einem sehr geringen Informationsverlust.
Abschließend stellt Kapitel VI Leistungen der Zusatzversorgungseinrichtungen für Tarifbeschäftigte des öffentlichen Dienstes dar; diese Daten sind kaufmännisch gerundet.
Bundesbedienstete im Sinne dieses Berichtes sind Beamtinnen und Beamte des Bundes, Richterinnen und Richter des Bundes, Berufssoldatinnen und Berufssoldaten. Beschäftigte im Sinne dieses Berichtes bezeichnet Tarifbeschäftigte der Bundesverwaltung.
Abgrenzung zur Vermögensrechnung des Bundes
Von dem Konzept dieses Berichts ist etwa die vom Bundesministerium der Finanzen jährlich veröffentlichte Vermögensrechnung des Bundes zu unterscheiden. Die dort unter bilanzieller Betrachtung ausgewiesenen Pensionsrückstellungen unterscheiden sich in ihrer Aussage grundlegend von den Angaben in diesem Versorgungsbericht. Diese Berichte können nicht uneingeschränkt miteinander verglichen werden (siehe dazu auch Kapitel IV, Tz. 1.2.).
2. Zusammenfassung des Achten Versorgungsberichts
Beamten-, Richter- und Soldatenversorgung des Bundes
Dieser Versorgungsbericht betrachtet die Entwicklungen unterschieden nach zwei Bereichen, zum einen den unmittelbaren Bundesbereich und zum anderen den sonstigen Bereichen des Bundes. Der unmittelbare Bundesbereich betrifft den Personenkreis der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Berufssoldatinnen und Berufssoldaten sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der Bundesbehörden, Bundesgerichte sowie rechtlich unselbstständigen Einrichtungen des Bundes. Dem unmittelbaren Bundesbereich wird aus langfristiger finanzieller Sicht betrachtet eine höhere Bedeutung zukommen als den sonstigen Bundesbereichen, da die Ausgaben für den unmittelbaren Bundesbereich stärkere Auswirkungen auf den Bundeshaushalt haben. In den sonstigen Bundesbereichen sind die rechtlich selbstständigen Einrichtungen erfasst, von denen viele selbst für die Finanzierung der Versorgungsausgaben ihrer ehemaligen Beamtinnen und Beamten zuständig sind, sowie die Beamtinnen und Beamten des Bundeseisenbahnvermögens und die bei den Postnachfolgeunternehmen. Die Ausgaben für die beiden zuletzt genannten Personenkreise werden wiederum von der DB AG und den Postnachfolgeunternehmen mitfinanziert. Seit der Privatisierung dieser beiden Bereiche erfolgen dort keine Neueinstellungen von Beamtinnen und Beamten mehr.
Der Schwerpunkt der zukünftigen Entwicklungen liegt somit auf dem unmittelbaren Bundesbereich. Nach den Vorausberechnungen dieses Versorgungsberichts werden sich die Versorgungsausgaben für den unmittelbaren Bundesbereich von rund 6,8 Mrd. Euro (in 2023) auf voraussichtlich 25,4 Mrd. Euro (in 2060) erhöhen. Die Finanzierbarkeit dieses Alterssicherungssystems, d. h. seine Tragfähigkeit, kann jedoch nicht ausschließlich an der Entwicklung der (absoluten) Höhe der Ausgaben bewertet werden. Für diese Bewertung wird das Verhältnis der Ausgaben des Bundes zum Bruttoinlandsprodukt (BIP), die sog. Versorgungsquote, und das Verhältnis zu den Steuereinnahmen des Bundes, die sog. Versorgungs-Steuer-Quote, betrachtet. 2060 wird für den unmittelbaren Bundesbereich die Versorgungsquote bei rund 0,22 Prozent (2023: 0,17 Prozent) und die Versorgungs-SteuerQuote bei rund 2,41 Prozent (2023: 1,92 Prozent) liegen.
Für die Hochrechnungen der Versorgungsausgaben wurde von einer durchschnittlichen jährlichen Bezügesteigerung von 2,9 Prozent in den Jahren 2025 bis 2060 ausgegangen. Diesen Bezügesteigerungen liegt die Annahme zugrunde, dass sich die künftigen Bezügeanpassungen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung orientieren. Eigens für diesen Bericht wurde dafür, aufsetzend auf der Frühjahrsprojektion 2024 der Bundesregierung, eine technische Fortschreibung des BIP erstellt, aus der sich für die Jahre 2025 bis 2060 eine durchschnittliche jährliche nominale Wachstumsrate von 2,9 Prozent ergibt.
Für die Entwicklung des Ausgabevolumens ist jedoch nicht nur die Entwicklung der Höhe der Bezüge, sondern auch die der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger wichtig. Das zeigt insbesondere die Versorgungsquote, deren Steigerung auf die Entwicklung der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Bundes zurückzuführen ist. Diese Größe wird im aktuellen Betrachtungszeitraum wesentlich von den gegenwärtigen Einstellungszahlen geprägt. So ist der Personalkörper des unmittelbaren Bundesbereiches zwischen den Jahren 2018 und 2023 um rund 17 Prozent gewachsen. Der stetige Stellenaufwuchs begann im Jahr 2015. Ab 2050 führt dieser Personalaufwuchs zu Kostensteigerungen für die Beamten- und Soldatenversorgung. Dieser Personalaufwuchs führt bei einem Vergleich der Vorausberechnungen des Siebten und dieses Versorgungsberichts zu Differenzen. Während der Siebte Versorgungsbericht ab 2038 noch ein Absinken der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger im unmittelbaren Bundesbereich ermittelte, zeigen die Berechnungen dieses Berichts einen stetigen Aufwuchs.
Mit Blick auf diese Entwicklung kommt den Sondervermögen, die zur (Mit-) Finanzierung der Beamten- und Soldatenversorgung geschaffen wurden, eine große Bedeutung zu. Es handelt sich dabei um die „Versorgungsrücklage des Bundes“ und den „Versorgungsfonds des Bundes“. Beide Vermögen befinden sich noch im Aufbau. Daher konnten die zukünftig zu erwartenden kostendämpfenden Wirkungen dieser Sondervermögen bei der Vorausberechnung der Versorgungsausgaben und auch bei der Bewertung der Tragfähigkeit des Versorgungssystems mangels derzeit noch nicht festgelegter Auszahlungsmodalitäten nicht berücksichtigt werden.
Die 1999 als Sondervermögen eingeführte Versorgungsrücklage des Bundes soll den Bundeshaushalt ab 2032 über einen Zeitraum von 15 Jahren schrittweise von Versorgungsausgaben entlasten. Die Finanzierung dieses Sondervermögens belastet den Bundeshaushalt nicht zusätzlich und ist vor diesem Hintergrund sehr interessant. Finanziert wird das Sondervermögen aus Einsparungen, die sich aus der Absenkung des Ruhegehaltssatzes um 4,33 Prozent nach dem Versorgungsänderungsgesetz 2001 und der Minderung von Bezügesteigerungen im Zeitraum 1999 bis 2024 um insgesamt 2,6 Prozentpunkte ergeben.
Wenn diese Maßnahmen nicht vorgenommen worden wären, wären diese Beträge an die Bezügeempfängerinnen und Bezügeempfänger ausgezahlt worden. Ende 2023 hatte das Sondervermögen einen Marktwert von rund 20,4 Mrd. Euro. Der Entlastungseffekt der nach aktueller Rechtslage vorgesehenen Verwendung des Sondervermögens wird für den Bundeshaushalt jedoch nur vorübergehend sein.
Daher wurde ein zweites Sondervermögen der „Versorgungsfonds des Bundes“ geschaffen. Es soll den Bundeshaushalt ab 2030 dauerhaft entlasten, indem es die Versorgungsausgaben für nach 2006 eingestellte Bundesbedienstete mitfinanziert. Dafür weisen die jeweiligen Dienstherren dem Sondervermögen Mittel zu. Diese Zuweisungen betragen durchschnittlich rund 32 Prozent der aktiven Dienstbezüge. Mit Stand 30. Juni 2023 besteht für rund 52 Prozent der aktiven Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter, Berufssoldatinnen und Berufssoldaten im unmittelbaren Bundesbereich eine Zuweisungspflicht; 2023 wurden Zuweisungen von knapp 2 Mrd. Euro geleistet. Ende 2023 hatte das Sondervermögen einen Marktwert von rund 12,9 Mrd. Euro. Die Zuweisungspflicht der Dienstherren besteht zusätzlich zu den zu zahlenden Dienstbezügen und wäre somit geeignet, disziplinierende Wirkung auf zusätzliche Personalforderungen zu haben, da der Bundeshaushalt die langfristigen Auswirkungen von Neueinstellungen durch die zusätzlich zu erbringenden Zuweisungen mitbeachten muss. Wie die Personalentwicklung seit 2015 jedoch zeigt, ist diese Wirkung begrenzt, wenn dem Personalbedarfe gegenüberstehen, die zur Erfüllung der Aufgaben notwendig sind.
Im Einzelnen zur Beamten-, Richter-, und Soldatenversorgung des Bundes Die Höhe der Versorgungsausgaben bestimmt sich aus der Anzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und der Höhe der Versorgungsbezüge. Diese werden beeinflusst durch die Entwicklung der Zugänge zum Versorgungssystem, das durchschnittliche Ruhestandseintrittsalter, die Gründe des Ruhestandseintritts sowie das durchschnittliche Versorgungsniveau.
Bis 2060 ist ein deutlicher Rückgang der Gesamtzahl der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger des Bundes zu erwarten. Zwischen 2025 und 2060 wird sie um rund 50 Prozent von 595 000 auf voraussichtlich 298 000 sinken. Die Reduzierung ist dabei auf den kontinuierlichen Rückgang beim Bundeseisenbahnvermögen und der Post zurückzuführen. Im unmittelbaren Bundesbereich hingegen wird die Anzahl insbesondere aufgrund des Personalaufwuchses in den Jahren 2015 bis 2023 stetig steigen (2025: 193 000; 2060: 230 000).
Die Zugänge zum Versorgungssystem werden durch das Ruhestandseintrittsalter, die Altersstruktur der aktiven Bundesbediensteten und in einem geringen Umfang auch durch nicht steuerbare Ereignisse, wie bspw. Dienstunfähigkeit oder Maßnahmen der Personalentwicklung, bestimmt. Während die Altersstruktur der Bundesbediensteten bereits Jahrzehnte vor dem Ruhestandseintritt durch die Einstellungspraxis bestimmt wird, stellt das Ruhestandseintrittsalter den einzigen Bestimmungsfaktor dar, der in vergleichbar kürzerer Zeit veränderbar ist und die Anzahl der Versorgungszugänge beeinflussen kann.
Im Jahr 2009 wurde die Anhebung der Altersgrenzen aus der gesetzlichen Rentenversicherung auf den Beamtenbereich übertragen. Sie hat sich als geeignete und vertretbare Maßnahme erwiesen, den Auswirkungen des demografischen Wandels entgegenzuwirken und der höheren Lebenserwartung Rechnung zu tragen.
Für die Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des unmittelbaren Bundesbereiches lag das durchschnittliche Ruhestandseintrittsalter 2023 bei 63 Jahren, das der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten bei 57 Jahren. Das durchschnittliche Ruhestandeintrittsalter des unmittelbaren Bundesbereiches wird insbesondere auch durch die besonderen Altersgrenzen2 beeinflusst. Die Beamtinnen und Beamten des Bundeseisenbahnvermögens begannen den Ruhestand im Durchschnitt mit 64,1 Jahren, die der Post mit rund 61,1 Jahren und in den übrigen Bundesbereichen mit 63,3 Jahren. Der im Vergleich mit den anderen Bereichen geringere Wert für den Bereich der Post ist insbesondere in einer bis Ende 2024 befristeten Vorruhestandsregelung begründet.
Der Anspruch auf eine Beamten-, Richter- oder Soldatenversorgung des Bundes besteht nur bei Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand. Ein Eintritt in den Ruhestand erfolgt grundsätzlich mit dem Erreichen einer Altersgrenze. Eine Versetzung in den Ruhestand kann erfolgen, wenn die Bundesbediensteten körperlich oder gesundheitlich nicht mehr in der Lage sind, die Dienstpflichten zu erfüllen und deswegen dauerhaft dienstunfähig ist (mit Abschlägen bis zu 10,8 Prozent).
Im Jahr 2023 begann für rund 5 985 Bundesbedienstete des unmittelbaren Bundesbereichs der Ruhestand. Der Großteil, rund 87,5 Prozent (5 240 Personen), trat wegen Erreichens einer Altersgrenze in den Ruhestand; davon 2 465 Beamtinnen und Beamte sowie Berufssoldatinnen und Berufssoldaten mit Erreichen einer besonderen Altersgrenze. Rund 1 285 (21,5 Prozent) Pensionärinnen und Pensionäre sind 2023 aufgrund eines Antrags ggf. unter der Hinnahme von Versorgungsabschlägen in einen vorgezogenen Ruhestand eingetreten. 1 055 Bedienstete des unmittelbaren Bundesbereiches (17,7 Prozent) haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Dienst geleistet. 435 Bundesbedienstete (7,2 Prozent) sind auf eigenen Antrag mit einem hinausgeschobenem Ruhestandsbeginn in den Ruhestand eingetreten. Der prozentuale Anteil der Pensionierungen aufgrund von Dienstunfähigkeit im unmittelbaren Bundesbereich liegt auf einem konstanten Niveau (2023 rund 12,1 Prozent, 2018 rund 12,2 Prozent); die Fallzahlen liegen weiterhin unter früherem Niveau, wenngleich sie steigen (im Jahr 2000 rund 1 200 Fälle,
im Jahr 2018 rund 580 Fälle, 2023 rund 725 Fälle). In den sonstigen Bereichen haben dagegen Ruhestandsversetzungen aufgrund von Dienstunfähigkeit eine größere Bedeutung; im Jahr 2023 lagen die Anteile für das Bundeseisenbahnvermögen bei 46,2 Prozent, bei der Post bei 32,7 Prozent und für die übrigen Bundesbereiche bei 23,1 Prozent.
Der nach 40 Jahren ruhegehaltfähiger Dienstzeit zu erreichende Höchstruhegehaltssatz beträgt 71,75 Prozent. Der tatsächlich erreichte Ruhegehaltssatz liegt in der Regel darunter. In der langfristigen Betrachtung zeigen sich in den meisten Bereichen steigende Tendenzen in Bezug auf den durchschnittlich erdienten Ruhegehaltssatz. Diese Entwicklung ist auf die längere Lebensarbeitszeit durch die Anhebung der Altersgrenzen sowie die Anerkennung von vor dem 17. Lebensjahr geleisteter Dienstzeiten als ruhegehaltfähig zurückzuführen. Der jährliche Steigerungssatz für geleistete ruhegehaltfähige Dienstzeit beträgt pro Jahr in Vollzeit unverändert 1,79375 Prozentpunkte. Bei den Zugängen des Jahres 2023 lag der durchschnittliche Ruhegehaltssatz bei den Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern des unmittelbaren Bundesbereiches bei 66,9 Prozent, für ehemalige Berufssoldatinnen und Berufssoldaten bei 70,9 Prozent, für das Bundeseisenbahnvermögen bei 70,6 Prozent, bei der Post 67,0 Prozent und für die übrigen Bundesbereiche bei 64,3 Prozent. Obwohl Berufssoldatinnen und Berufssoldaten wegen der besonderen Altersgrenzen deutlich weniger ruhegehaltfähige Dienstzeiten leisten können, erreicht diese Beschäftigtengruppe einen vergleichsweise hohen durchschnittlichen Ruhegehaltssatz.
Ursächlich dafür sind auch die Regelungen zur Erhöhung des Ruhegehaltssatzes nach § 26 SVG durch Berücksichtigung von Zeiten ohne Dienstleistungsverpflichtung als ruhegehaltfähig.
In fast allen Bereichen erreichten die weiblichen Bediensteten durchschnittlich niedrigere Werte als ihre männlichen Kollegen. Hintergrund sind bspw. Unterbrechungen der Erwerbsbiografien wegen Beurlaubungen (z. B. aufgrund von Kindererziehung) und das Arbeiten in Teilzeit. Lediglich die ehemaligen Beamtinnen und Beamten des BEV im höheren Dienst erreichten vergleichbare Werte (69,3 Prozent und 69,5 Prozent).
Im Jahr 2023 sind rund 55,5 Prozent der Pensionärinnen und Pensionäre aus dem Bereich der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des unmittelbaren Bundesbereiches mit dem Höchstruhegehaltssatz in den Ruhestand getreten. Dieser Anteil sinkt; 2019 lag er bei 59,9 Prozent. Hingegen ist der Anteil der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten, der mit Höchstruhegehaltssatz den Ruhestand getreten ist, von 76,6 Prozent in 2019 auf rund 81,3 Prozent in 2023 gestiegen. Das Bundeseisenbahnvermögen hatte mit 87,8 Prozent den höchsten Anteil an Zurruhesetzungen mit Höchstruhegehaltssatz. Für den Bereich der Post und der übrigen Bundesbereiche liegt er bei 59,2 Prozent und 44,5 Prozent.
Wird das Ruhegehalt vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze in Anspruch genommen, wird das Ruhegehalt um 3,6 Prozent für jedes vor der gesetzlichen Altersgrenze liegende Jahr vermindert. Das erfolgt grundsätzlich in Fällen der vorzeitigen Versetzung in den Ruhestand auf Antrag (bis zu 14,4 Prozent) oder wegen Dienstunfähigkeit (bis zu 10,8 Prozent). Der Versorgungsabschlag reduziert stets das Ruhegehalt und nicht den Ruhegehaltssatz, sodass die oben genannten Werte zu den Ruhegehaltssätzen diese Reduzierung noch nicht berücksichtigen. 2023 wurde für rund 23,9 Prozent der ehemaligen Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter des unmittelbaren Bundesbereiches und rund 2,8 Prozent der Berufssoldatinnen und Berufssoldaten die Versorgung aus diesem Grund gemindert. Beim Bundeseisenbahnvermögen lag der Anteil bei 14,3 Prozent, bei der Post bei 18,9 Prozent; in den übrigen Bundesbereichen liegt der Anteil mit 43,0 Prozent am höchsten.
Die sog. Mindestversorgung ist eine versorgungsrechtliche Untergrenze, die ihre Rechtfertigung im Alimentationsprinzip findet. Sie soll der Beamtin bzw. dem Beamten, der Richterin bzw. dem Richter, der Berufssoldatin bzw. dem Berufssoldaten und ihrer bzw. seiner Familie ein Existenzminimum für den Fall sichern, dass die nach den allgemeinen Versorgungsregelungen berechneten, sog. erdienten Versorgungsbezüge, eine amtsangemessene Alimentation nicht gewährleisten. Rund 5,5 Prozent aller Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger des unmittelbaren Bundesbereiches erhielten am 1. Januar 2024 eine Mindestversorgung. Dieser Anteil weist steigende Tendenzen auf, insbesondere in der Personengruppe der Empfängerinnen und Empfänger einer amtsunabhängigen Mindestversorgung.
3 Ein Zusammenhang zu einer Ruhestandsversetzung aufgrund von Dienstunfähigkeit ist nicht erkennbar. Auffallend ist hingegen, dass unter den Zugängen zum Versorgungssystem deutlich mehr Frauen eine Mindestversorgung erhielten. Ihr Anteil lag im unmittelbaren Bundesbereich mit 25,3 Prozent (2018 rund 31,8 Prozent) deutlich höher als in der männlichen Vergleichsgruppe mit 4,0 Prozent (2018 rund 3,8 Prozent). Für die Bereiche des BEV und der Post lag der Anteil der Mindestversorgung insgesamt bei 6,2 Prozent und 22,9 Prozent, wobei auch in diesen Bereichen 33,7 Prozent (Bundeseisenbahnvermögen) und 45,8 Prozent (Post) der Zugänge zum Stichtag 1. Januar 2024 Frauen waren.
Altersgeld des Bundes
Bundesbedienstete, die vor Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand aus dem Bundesdienst ausscheiden, haben keinen Anspruch auf eine Beamten-, Richter- oder Soldatenversorgung. In diesen Fällen erfolgt grundsätzlich eine Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung.
Im Jahr 2013 hat der Bund ein alternatives Alterssicherungssystem für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter sowie Berufssoldatinnen und Berufssoldaten geschaffen, die aus dem Bundesdienst vor Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand auf eigenen Antrag entlassen werden möchten und für die Nachversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung durchzuführen wäre. Dieser Personenkreis kann anstatt der Nachversicherung ein sog. Altersgeld wählen. Diese Alterssicherung orientiert sich unter Hinnahme von pauschalen Abschlägen, die anhand der Dauer der beim Bund geleisteten Dienstzeit ermittelt werden, an den Grundsätzen der Beamtenversorgung.
Innerhalb von sechs Monaten nach der Entlassung werden zunächst die altersgeldfähigen Dienstbezüge und die altersgeldfähige Dienstzeit festgesetzt (= Altersgeldfestsetzung). In den Jahren 2019 bis 2022 erfolgten im gesamten Bundesbereich durchschnittlich rund 145 Altersgeldfestsetzungen pro Jahr. Das Durchschnittsalter bei der Entlassung betrug rund 40 Jahre, wobei rund 72 Prozent 50 Jahre und jünger waren. Wie in den Jahren 2014 bis 2018 ist auch in diesem Betrachtungszeitraum im gesamten Bundesbereich eine höhere Inanspruchnahme-Quote durch weibliche Bundesbedienstete festzustellen.
Der Anspruch auf Auszahlung des Altersgelds ruht grundsätzlich bis zum Ablauf des Monats, in dem die Regelaltersgrenze in der gesetzlichen Rente erreicht wird. Bei Vorliegen einer Schwerbehinderung, Erwerbsminderung oder Berufsunfähigkeit kann das Altersgeld vorzeitig mit Abschlägen in Anspruch genommen werden. Am 1. Januar 2024 gab es im gesamten Bundesbereich rund 15 Altersgeldempfängerinnen und Altersgeldempfänger.
Mit Blick auf die vergleichsweise geringe Anzahl der durchschnittlichen jährlichen Altersgeldfestsetzungen wird von einer Größenordnung von ungefähr 2 900 ehemaligen Bundesbediensteten pro Jahr ausgegangen, denen ab 2060 Altersgeld ausgezahlt werden könnte. Das entspricht weniger als 1,3 Prozent der erwarteten Ruhegehaltsempfängerinnen und Ruhegehaltsempfänger des Bundes (221 000). Aufgrund des pauschalen Abschlags und der kürzeren altersgeldfähigen Dienstzeiten werden die Ausgaben für das Altersgeld gemessen an den Versorgungsausgaben des Bundes deutlich geringer ausfallen.
Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
Die Zusatzversorgung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes gehört zum Bereich der betrieblichen Altersversorgung. Dieser Bericht beschränkt sich bei der Darstellung der Entwicklungen der Versorgungsleistungen der Zusatzversorgungseinrichtungen auf diejenigen, bei denen Tarifbeschäftigte der Bundesverwaltung versichert sind oder die durch den Bund finanziert werden. Dies betrifft im Ergebnis die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See (DRV KBS).
Die Anzahl der Pflichtversicherten bei der VBL, die Beschäftigte in der Bundesverwaltung sind, ist weiter gestiegen. Sie ist von 694 732 im Jahr 2019 auf 719 822 im Jahr 2023 gestiegen (352 620 aktiv und 367 202 beitragsfrei). Damit ist die Gesamtzahl der Pflichtversicherten zwischen 2019 und 2023 um 3,6 Prozent gestiegen.
Das durchschnittliche Renteneintrittsalter bei der VBL steigt. Im Vergleich zum Jahr 2018, in dem das Eintrittsalter bei 62 Jahren lag, stieg es im Jahr 2023 auf 62,4 Jahre. Die Anzahl der Renten bei der VBL für die Beschäftigten in der Bundesverwaltung ist von 295 762 im Jahr 2019 auf 306 347 im Jahr 2023 gestiegen. Dies ist ein Anstieg um 3,6 Prozent.
Die Ausgaben der VBL für Versorgungsleistungen sind ebenfalls gestiegen: zwischen 2019 und 2023 von 1 206,6 Mio. Euro auf 1 228,5 Mio. Euro um 1,8 Prozent. Bis zum Jahr 2060 werden die Ausgaben für Versorgungsleistungen der VBL voraussichtlich auf rund 2 853 Mio. Euro steigen.
Der Anteil der Versorgungsleistungen am BIP bis 2060 ist nach den Vorausberechnungen leicht rückläufig. Unter der Annahme der Entgeltanpassungen entsprechend der unterstellten Entwicklung des BIP sinkt der Anteil der Versorgungsleistungen am BIP von 0,03 Prozent im Jahr 2025 auf 0,02 Prozent im Jahr 2060.
3. Ausgewählte Themen
Es werden ausgewählte Themenbereiche mit Bezug zur Alterssicherung von Beamtinnen und Beamten des Bundes vorgestellt.
3.1. Die digitale Auskunftsplattform „Versorgungsrechner Online“
Im Juni 2023 ist das Self-Service-Portal „Versorgungsrechner Online“ in Betrieb gegangen. Bereits der Koalitionsvertrag der 19. Legislaturperiode forderte, dass – unabhängig vom Alterssicherungssystem – Bürgerinnen und Bürger über ihre Absicherung im Alter Informationen erhalten und in die Lage versetzt werden sollen, Handlungsbedarf frühzeitig erkennen zu können. Dafür wurde unter Federführung des BMAS die sog. Digitale Rentenübersicht entwickelt. Da die Beamtenversorgung des Bundes in absehbarer Zeit nicht angebunden werden kann 4 hat der Bund ein gesondertes Serviceangebot bereitgestellt: den Versorgungsrechner Online.
Wenngleich das Portal auch durch die Öffentlichkeit genutzt werden kann, richtet es sich vornehmlich an Bundesbeamtinnen und Bundesbeamte sowie Richterinnen und Richter des Bundes. Nutzerinnen und Nutzer können sich durch Selbsteingabe ihrer Daten kurzfristig einen umfassenden, wenn auch unverbindlichen Überblick über ihre Alterssicherungsansprüche aus der Beamtenversorgung des Bundes verschaffen.
Diverse Eingabehinweise und ausführliche Erläuterungen ermöglichen eine Nutzung auch ohne versorgungsrechtliche Vorkenntnisse. Dieses Onlineangebot ergänzt den bereits bestehenden gesetzlichen, aber antragsgebundenen Anspruch auf eine schriftliche Auskunft durch eine Versorgungsdienststelle. Diese Auskunftsmöglichkeit ist gleichwohl auch weiterhin erforderlich.
Besonders komplexe rechtliche Fallkonstellationen können ausschließlich durch qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Versorgungsdienststellen bei vollständiger Kenntnis des Einzelfalls bewertet werden.
Langfristig soll dieser digitale Service die Versorgungsdienststellen entlasten. Gleichzeitig soll erreicht werden, dass sich Nutzerinnen und Nutzer bereits frühzeitig umfassend mit ihren Alterssicherungsansprüchen auseinandersetzen. Im ersten Betriebsjahr wurden rund 110 000 Versorgungsauskünfte erstellt.5 Das Portal ist über einen Link auf der BMI-Website im
Themenbereich „Öffentlicher Dienst“ jederzeit und ohne Log-In erreichbar. Es wurde als Projekt der „Dienstekonsolidierung“ und Teil der Maßnahme „PVS Bund“ durch das ITZBund im Auftrag des BMI entwickelt. Das Serviceangebot wird laufend weiterentwickelt und an aktuelle Rechtslagen und Bedarfe der Nutzerinnen und Nutzer angepasst.
Der Versorgungsrechner Online kann
- anhand der Eingaben eine Berechnung der aktuell erreichten sowie der voraussichtlichen Versorgungsansprüche transparent und nachvollziehbar darstellen,
- Alternativberechnungen ermöglichen, um Auswirkungen von etwaigen zukünftigen Arbeitszeitreduzierungen oder Beurlaubungen auf die Versorgungsansprüche darzustellen,
- die Auswirkungen einer auf die Versorgung anzurechnenden gesetzlichen Rente oder laufenden Alterssicherungsleistung von einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung sowie die Auswirkungen einer rechtskräftigen Entscheidung des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich auf die Versorgung der ausgleichspflichtigen Person aufzeigen.
Die eingegebenen Daten können nicht von Dritten eingesehen werden und sehen keinerlei Personenbezug wie Name, Personalnummer, Anschrift, Dienststelle, usw. vor. Es besteht keine Schnittstelle zu anderen Anwendungen, die persönliche Daten enthalten oder weiterverarbeiten. Die von den Nutzerinnen und Nutzern eingegebenen Daten werden nur für die jeweilige Session temporär gespeichert und genutzt, um die Berechnung der Versorgungsbezüge durchführen zu können. Die Berechnung kann jederzeit abgebrochen und die Daten auf einem Endgerät der Nutzerin bzw. des Nutzers abgespeichert und im Fall einer späteren Nutzung des Versorgungsrechners wieder hochgeladen werden. Nicht gespeicherte Daten werden gelöscht und müssen bei einer erneuten Nutzung des Portals neu eingegeben werden.
3.2. Anlage der Sondervermögen zur Finanzierung von Versorgung und Nachhaltigkeit
Das System der Beamten-, Richter- und Soldatenversorgung des Bundes ist derzeit haushaltsfinanziert. Mittlerweile gibt es beim Bund Sondervermögen, mit denen diese Finanzierungsbasis durch kapitalmarktgestützte Lösungen erweitert wird bzw. werden soll (vgl. KAPITEL III).
Die Deutsche Bundesbank legt die Mittel der Sondervermögen unter Wahrung der gesetzlichen Anlagegrundsätze Sicherheit, Liquidität und Rendite in festverzinsliche Wertpapiere und in Aktien an. Auch das zunehmend wichtige Thema Nachhaltigkeit fließt in die Anlagestrategie ein. Mit Blick auf die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie zur Umsetzung der 17 UNNachhaltigkeitsziele gilt ein Nachhaltigkeitskonzept für die Aktienanlage.
Das Konzept berücksichtigt Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsbelange als Kriterien und Rahmenbedingungen (sog. ESG-Kriterien). ESG setzt sich aus den Begriffen Environment (Umwelt), Social (Soziales) und Governance (Unternehmensführung) zusammen. Mithilfe dieser Kriterien können Unternehmen und Organisationen hinsichtlich verschiedener NachhaltigkeitsundEthikfragen der drei Aspekte Umwelt (z. B. Ressourcen- und Artenschutz), Soziales (z. B. Arbeitsbedingungen und -sicherheit) und Unternehmensführung (z. B. Schutz vor Ausbeutung oder Korruption) bewertet werden. Zusätzlich werden Ausschlusskriterien kombiniert. Diese sind z. B. die Produktion und der Handel mit verbotenen/geächteten Waffen, schwere und systematische Verstöße gegen internationale Menschenrechtsabkommen oder der Betrieb von Kernkraftwerken. Die Kapitalanlage in Unternehmen, auf die diese Kriterien zutreffen, ist von vornherein ausgeschlossen.
Seit August 2021 erfolgen die Aktieninvestitionen der Sondervermögen in zwei nachhaltige Aktienindizes, die den EU Climate Transition Benchmark-Standard erfüllen. Diese fortlaufende Reduzierung der CO2-Intensität der Sondervermögen dient dem im „Koalitionsvertrag von 2021 -2025“6 vereinbarten Ziel, der Klimaneutralität bis 2045 widersprechende öffentliche Geldanlagen schrittweise abzuziehen. Mit der Investition in verschiedene Geldanlagemöglichkeiten und ohne den Ausschluss ganzer Branchen wird eine breite Risikostreuung gewährleistet. Mit dieser nachhaltigen Anlage sind die Sondervermögen nicht nur rentabel und sicher investiert, die Anlage richtet sich auch an nationalen und europäischen Klimazielen aus.
3.3. Das Altersgeld des Bundes
Das Altersgeld des Bundes ist eine Alterssicherungsleistung, die seit rund zehn Jahren zur Verfügung steht. Das 2013 geschaffene Alterssicherungssystem steht Bediensteten zur Verfügung, die vor Eintritt oder Versetzung in den Ruhestand freiwillig auf eigenen Antrag aus dem Bundesdienst ausscheiden und für die eine Nachversicherung in der GRV durchzuführen wäre. Im Fall des Ausscheidens besteht kein Anspruch auf eine Beamten-, Richter- oder Soldatenversorgung. Mit Inkrafttreten des AltGG am 4. September 2013 wurde eine Wahlmöglichkeit zwischen dem Altersgeld des Bundes und einer Nachversicherung in der GRV geschaffen.
Zielrichtung
Da die Nachversicherung in der GRV ausschließlich die sog. erste Säule der Alterssicherung in Deutschland (Regelsicherung) bedient, führt sie - im Vergleich zur Beamtenversorgung - oftmals insgesamt zu geringeren Alterssicherungsleistungen. Das Altersgeld des Bundes soll diese Unterschiede abbauen und so die Mobilität und Attraktivität des öffentlichen Dienstes erhöhen.
Anspruch auf Altersgeld des Bundes
Ein Anspruch auf Altersgeld des Bundes besteht nur bei einer Entlassung auf Antrag, wenn zum Zeitpunkt der Entlassung dringende dienstliche Gründe nicht entgegenstehen und vor Beendigung des Dienstverhältnisses eine Erklärung gegenüber dem Dienstherrn abgegeben wird, anstelle der Nachversicherung in der GRV das Altersgeld in Anspruch nehmen zu wollen.
Sofern das Altersgeld des Bundes in Anspruch genommen wird, erfolgt keine Nachversicherung in der GRV. Wurde bereits eine Nachversicherung (zum Beispiel aufgrund einer unterlassenen Erklärung über die Inanspruchnahme von Altersgeld) durchgeführt, kann diese nicht rückgängig gemacht werden. Bedienstete müssen zudem eine altersgeldfähige Dienstzeit von mindestens fünf Jahren abgeleistet haben, davon mindestens vier beim Dienstherrn Bund.
Der Anspruch auf Altersgeld entsteht mit Ablauf des Tages, an dem das Dienstverhältnis endet.
Eine Auszahlung erfolgt nur auf Antrag und grundsätzlich erst nach Ablauf des Monats, in dem die oder der Berechtigte die Regelaltersgrenze erreicht; bis dahin ruht der Anspruch auf das Altersgeld. Im Fall des Vorliegens von Erwerbsminderung oder Schwerbehinderung ist es möglich, die Beendigung des Ruhens vorzeitig und unter Hinnahme von Abschlägen zu beantragen.
Höhe des Altersgeldes des Bundes
Die Höhe bestimmt sich in Anlehnung an die Beamtenversorgung des Bundes nach den zuletzt erhaltenen Bezügen und der geleisteten Dienstzeit. Der Altersgeldsatz beträgt 1,79375 Prozent für jedes Jahr altersgeldfähiger Dienstzeit in Vollzeit, höchstens jedoch 71,75 Prozent. Der Altersgeldsatz wird pauschal reduziert, um zu verhindern, dass ein zu starker Anreiz entsteht, den öffentlichen Dienst vorzeitig zu verlassen. Der Abschlag soll zudem die Kosten ausgleichen, die dem Dienstherrn durch die vorzeitige Entlassung entstehen. Diese Reduzierung beträgt 15 Prozent, wenn eine altersgeldfähige Dienstzeit von weniger als zwölf Jahren vorliegt, bzw. fünf Prozent, wenn die altersgeldfähige Dienstzeit mindestens zwölf Jahre beträgt.
Hinterbliebene der oder des Altersgeldberechtigten erhalten ebenfalls Leistungen. Witwen bzw. Witwern stehen 55 Prozent des Altersgelds als Witwenaltersgeld, Halbwaisen 12 Prozent und Vollwaisen 20 Prozent des Altersgelds als Waisenaltersgeld zu.
Sowohl Renten als auch anderweitige Versorgungsleistungen, die auf vor Ausscheiden aus dem Dienst- und Treueverhältnis erworbenen Anwartschaften beruhen, sowie Einkommen aus Beschäftigungen werden auf das Altersgeld des Bundes angerechnet.
Das vorteilhafte Depot comdirect Depot inkl. 100 ? Prämie
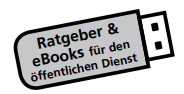 |
Interessantes Angebot zum Komplettpreis von 22,50 Euro inkl. Versand & MwSt. Der INFO-SERVICE Öffentliche Dienst/Beamte informiert seit 1997 - also seit mehr als 25 Jahren - die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zu wichtigen Themen rund um Einkommen und Arbeitsbedingungen, u.a. auch zum Thema rund um das Beamtenversor-gungsrecht. Auf dem USB-Stick (32 GB) sind 8 Bücher aufgespielt, davon drei Online-Bücher Wissenswertes für Beamtinnen und Beamte, Beamtenversorgung in Bund und Ländern und Beihilferecht in Bund und Ländern. Ebenfalls auf dem Stick: 5 eBooks: Nebentätigkeitsrecht, Tarifrecht (TVöD, TV-L), Berufseinstieg im öff. Dienst, Rund ums Geld im öffentlichen Sektor und Frauen im öffentlichen Dienst >>>Hier zum Bestellformular |
Red 20250809